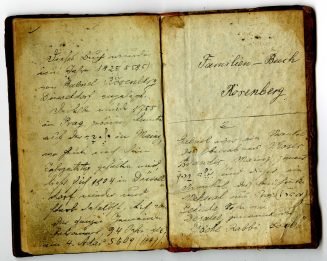Maria
ObjektbezeichnungFigur
Hersteller*in
Unbekannt
Provenienz
Hermann Josef Lückger
(1864–1951)
Datierung1500-1650?
Material/TechnikPfeifenton aus zweischaligem Model gedruckt
Maße(H x B x T): 4,6 x 1,6 x 1,5 cm
BeschreibungMit vor der Brust gekreuzten Händen stehende Figur, Standbein rechts, Spielbein links, die in einen weiten Mantel gekleidet ist, der auf der Rückseite in einer markanten Faltelage ausläuft, die an ein umgekehrtes Y erinnert. Über dem Kopf liegt ein Schleiertuch. Auf Standfläche. Ovales Stockloch von max. 3 mm Durchmesser.Beitrag G.V. Grimm:
Mit vor der Brust gekreuzten Armen stehende Maria. Roswitha Neu-Kock: Pfeifentonfiguren - Eine volkstümliche Kunstgattung. Beiträge zur Keramik 4 (Düsseldorf 1992) Nr. 48 S. 19 datiert die Kleinplastik, die sie zu Recht als Teil einer Kreuzigungsgruppe anspricht, in das 15. Jahrhundert. Die leichte Wendung des Oberkörpers zu der linken Seite der Figur und das trauernd geneigte Haupt lassen in Verbindung mit dem Gestus der ergeben vor der Brust gekreuzten Hände eigentlich keine andere Interpretation zu. Ein aus einer jüngeren Modelgeneration stammender Streufund aus Karlstadt wurde in das frühe 16. Jh. datiert (Bayerische Vorgeschichtsblätter Beiheft 17, 2001/02, Abb. 148.7 S. 248, 275). Ein weiteres Stück stammt aus dem mutmaßlichen Herstellungsort Karlstadt, Flur Hirschfeld, von dem zum einen Funde der Zeit um 1400, zum anderen des ausgehenden 15. bis frühen 16. Jahrhunderts zum Vorschein kamen (Stefan Gerlach, Mittelalterliche und frühneuzeitliche Tonfiguren aus Unterfranken. In: Mainfränkische Studien, Band 63, 1998, S. 192-210, Nr. 21 S. 196 f.).
Derartig einfache Schleiertücher sind zwar auch bereits bei Mariendarstellungen des 15. Jahrhunderts zu finden, doch für die Tragweise sind aus dieser Zeit keine Parallelen bekannt. Starre Gewandfalten wiederum waren in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts üblich, während die einfach über den Kopf gelegten Tücher bereits am Ende des 15. Jahrhunderts üblich werden, als sich Knitterfalten bereits allgemein durchgesetzt haben. Bildung und spiraliger Schwung des Körpers zeigen die Kenntnis von Gestaltungsprinzipien des Manierismus. Gerade im ausgehenden Manierismus und im Frübarock um 1620-1650 waren auch freie Rückgriffe auf Trachten der Dürerzeit üblich. Möglicherweise entstammt die Figur auch dieser Epoche.
KlassifikationAngewandte Kunst / Kunstgewerbe - Keramik
Herstellungsort
- Rheinland
- Deutschland
SchlagwortMadonna
SchlagwortPfeifenton
ObjektnummerHM.LR-1906
Institution
Hetjens-Museum
Abteilung
Hetjens-Museum