Object numberP 1940-135
Goldrubin-Walzenkrug mit Jahreszeiten-Darstellung
TitelGold ruby glass tankard with personifications of the four seasons
NameWalzenkrug
Künstler*inGlasschnitt
Gottfried Spiller
oder Umkreis (Schlesien ca. 1663‒vor 1728 Berlin)
Provenienzehemals Sammlung
Johannes Jantzen
(Shanghai 1887–1972 Bremen)
Provenienzehemals
Sammlung Reichenheim-Oppenheim
(1857 - 1935)
Dateca. 1700–1725
MediumDunkelrotes massives Goldrubinglas, formgeblasen, geschliffen, geschnitten; Silber, getrieben, vergoldet, graviert, mit Applikation
ReignBarock
Dimensions(H x B x T): 14,6 x 12,3 x 9,4 cm
DescriptionWalzenförmig mit angeschmolzenem Henkel; Dekor in poliertem Schliff und Tiefschnitt: Putten als Allegorien der vier Jahreszeiten. Silberdeckel mit Daumenrast und Scharnier; applizierte Minervabüste in Silberrelief. Silberstandring. Teil der durch Johann Kunckel initiierten Goldrubinproduktion der Potsdamer Hütte.Notes
- Die ausgezeichnete Glasschnittarbeit zeigt Putti als Personifikationen der Vier Jahreszeiten. Reines Gold, in Gestalt nanometergroßer Partikel, verursacht die leuchtend rubinrote Farbe dieses Glases. Die Herstellung solcher Gläser ist jedoch ungemein schwierig. Ein Verfahren ist von dem Alchemisten Johann Rudolph Glauber (1604 – 1670) um die Mitte des 17. Jahrhunderts entdeckt worden. Glauber ging es freilich nicht um die Schönheit der Farbe. Er meinte, die „Essenz“ des Goldes gefunden zu haben, und damit den Schlüssel zur „Transmutation“, der Metallumwandlung, die von Alchemisten schon seit Jahrhunderten ersehnt worden war. Einige Jahrzehnte später machte der Glasmacher und Alchemist Johann Kunckel (1637? – 1703) sich Glaubers Technik in Potsdam zunutze, um die ersten großen Goldrubingefäße herzustellen. Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg (reg. 1640 – 1688) schenkte Kunckel für diesen Erfolg die Pfaueninsel bei Berlin.
Klassifikation(en)
Entstehungsort
Copyright DigitalisatFoto: Kunstpalast, Düsseldorf
Bibliography Text- Jantzen 1960, S. 37, Nr. 106, Taf. 50;- Heinemeyer, Glas, Düsseldorf 1966, Kat.Nr. 384;
- Ricke, 2500 Jahre, 1987, Kat.Nr. 84;
- Ricke, Reflex 1989, Kat.Nr. 162;
- Ricke, Reflex 1995, Kat.Nr. 165.
- Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, Rubinglas des ausgehenden 17. und des 18. Jahrhunderts, Mainz 2001, S. 100-101 und 204, Nr. 195;
- Dedo von Kerssenbrock-Krosigk: Goldrubinglas. Eine Berliner Privatsammlung und die Bestände des Glasmuseums Hentrich, Ausst. Düsseldorf (spot on 03) 2009, S. 11.
- Dedo von Kerssenbrock-Krosigk: Vetro rubino all¿oro: tradizione e conquista di un colore, in: Aldo Bova (Hrsg.): L¿Avventura del vetro dal Rinascimento al Novecento tra Venezia e mondi lontani 2010, S. 43-49, Nr. III.8, S. 341 u. 512.
- Dedo von Kerssenbrock-Krosigk: Glasmuseum Hentrich, in: Die Sammlung. Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Düsseldorf 2011, S. 274-325, hier S. 303.
- Uta Kaiser, Gläserne Welten, in: MuseumsJournal Berlin & Potsdam, 2017, Nr. 3, S. 80.
- Uta Kaiser, Gläserne Welten, in: Potsdamlife-Magazin, 2017, Ausgabe 49, S. 49
Collections
Institution
Kunstpalast
Department
Kunstpalast - Glassammlung
ProvenanceUm 1720 entstanden in Potsdam; […]; spät. 1914 Margarete Oppenheim (Leipzig 1857 - 2.9.1935 Berlin), Berlin; […]; ? - spät. 1940 Dr. Johannes Jantzen (Shanghai 1887 - 1972 Bremen), Bremen; 7.1.1941 angekauft von Johannes Jantzen
Forschungsstand: Februar 2023
Dieses Werk ist aktuell Gegenstand der Provenienzforschung der Landeshauptstadt Düsseldorf: Wir untersuchen die Besitz- und Eigentumsgeschichte. Falls Sie Fragen haben oder weitergehende Informationen zu dem Werk benötigen, richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail an provenienzforschung@duesseldorf.de oder postalisch an:
Landeshauptstadt Düsseldorf
Dezernat für Kultur und Integration
Provenienzforschung
Zollhof 13
40221 Düsseldorf
Forschungsstand: Februar 2023
Dieses Werk ist aktuell Gegenstand der Provenienzforschung der Landeshauptstadt Düsseldorf: Wir untersuchen die Besitz- und Eigentumsgeschichte. Falls Sie Fragen haben oder weitergehende Informationen zu dem Werk benötigen, richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail an provenienzforschung@duesseldorf.de oder postalisch an:
Landeshauptstadt Düsseldorf
Dezernat für Kultur und Integration
Provenienzforschung
Zollhof 13
40221 Düsseldorf
MarkingsUnbezeichnet
ohne Jahr












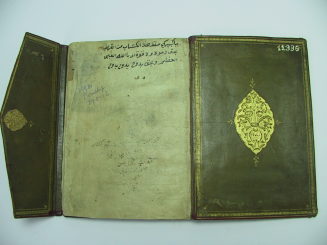



![[[missing key: :media.image-unavailable-label]]](/assets/skin/z56c3851/images/Platzhalter.svg)