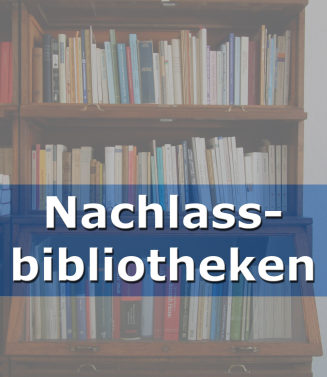Max Burchartz
- Max Burchartz
1887 - 1961
Biographie Junges Rheinland
- Max Burchartz wird am 28. Juli 1887 in Elberfeld als Sohn des Fabrikanten Otto Burchartz und dessen Frau Maria Giani geboren. Er wächst in vermögenden Verhältnissen auf und beginnt nach der Schule zunächst eine kaufmännische Ausbildung. Anschließend besucht er die Textilfachschule und die Kunstgewerbeschule in Barmen, bevor er 1907 ein Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie aufnimmt, wo er Schüler von Walter Corde wird. 1914 wird Burchartz zum Kriegsdienst eingezogen. Nach seiner Zeit als Soldat zieht er sich nach Blankenhain in Thüringen zurück. Bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit knüpft er von dort Kontakte zu avantgardistischen Künstlerkreisen und wird Mitglied der Berliner Novembergruppe. Zwischen 1919 und 1924 lebt Burchartz abwechselnd in Düsseldorf, Weimar und Hannover, wo er zum Kreis um Kurt Schwitters gehört. 1919 schließt er sich auch dem Jungen Rheinland an, an dessen Ausstellungen er bis 1922 teilnimmt. Ebenfalls 1919 erscheinen zehn Steinzeichnungen von Burchartz zu Dostojewskis Roman Raskolnikoff als Mappenwerk der Galerie Flechtheim, wo der Künstler bis 1921 unter Vertrag ist.
Im August 1922 besucht Burchartz einen De Stijl-Kurs bei Theo van Doesburg am Bauhaus in Weimar, infolge dessen er sich verstärkt dem Konstruktivismus zuwendet. Burchartz nimmt im selben Jahr am Kongress der Konstruktivisten und Dadaisten in Weimar teil und trifft dort auf Künstler wie Hans Arp, Tristan Tzara, El Lissitzky und László Moholy-Nagy. Er beginnt nebenher als Übersetzer für das Bauhaus zu arbeite und beschäftigt sich mit Typografie.
Ab 1924 lebt Burchartz im Ruhrgebiet. Er gründet in Bochum die erste moderne Werbeagentur in Deutschland, die unter dem Namen werbe-bau rasch floriert. Ab 1926 entwirft Burchartz zusätzlich Möbel und ist für den Deutschen Werkbund tätig. Zwischen 1927 und 1931 hat er eine Professur für Typografie an der Folkwangschule in Essen, die infolge der Wirtschaftskrise gestrichen wird.
In der Hoffnung auf bessere Arbeitsmöglichkeiten tritt Burchartz 1933 der NSDAP bei. Er erhält bis 1939 wiederholt Aufträge aus der Deutschen Industrie (für Drucksachen und Prospekte), kann jedoch nicht verhindern, dass 1937 im Rahmen der Aktion „Entartete Kunst" über 20 seiner Werke aus öffentlichen Sammlungen beschlagnahmt werden. 1939 meldet er sich freiwillig zum Kriegsdienst.
1949 wird Burchartz erneut an die Folkwangschule in Essen berufen. Er knüpft dort didaktisch an seine Zeit am Bauhaus an.
Max Burchartz stirbt am 31. Januar 1961 in Essen.
Ausstellungen (DJR):
DJR 1919, Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 22. Juni – 20. Juli 1919 (Kat.-Nr. 28-31)
Erste Wanderausstellung DJR, Ruhmeshalle Barmen, 02. – 30. November 1919 (Kat.-Nr. 12-13)
Zweite Wanderausstellung DJR, Kunstmuseum Essen, 20. Januar – 20. Februar 1920 (Kat.-Nr. 12-13)
DJR auf der Großen Kunstausstellung Düsseldorf 1920, Städtischer Kunstpalast Düsseldorf, 15. Mai – 03. Oktober 1920 (Kat.-Nr. 174-180)
Frühjahrsausstellung 1921 der Künstlervereinigung „Das Junge Rheinland" in Nürnberg, Kunsthalle am Marientor, 06. Februar – 13. März 1921 (Kat.-Nr. 18-26)
DJR 1921, Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 27. Februar – 29. März 1921 (Kat.-Nr. 28-30)
I. Internationale Kunstausstellung Düsseldorf im Hause Leonhard Tietz, 28. Mai – 03. Juli 1922 (Kat.-Nr. 48-49)
Literatur:
Max Burchartz 1887–1961. Zeichnungen, Gouachen, Aquarelle, Druckgraphik, Ausst.-Kat. Museum Folkwang Essen, Essen 1965.
Breuer, Gerda (Hrsg.), Max Burchartz 1887-1961. Künstler, Typograph, Pädagoge, Ausst.-Kat. Meisterhaus Klee – Kandinsky der Stadt Dessau-Roßlau, Berlin 2010.
AKL-Nummer10146760
Nationalität: DE
DE, 1875 - 1942

![[[missing key: :media.image-unavailable-label]]](/assets/skin/z56c3851/images/Platzhalter.svg)